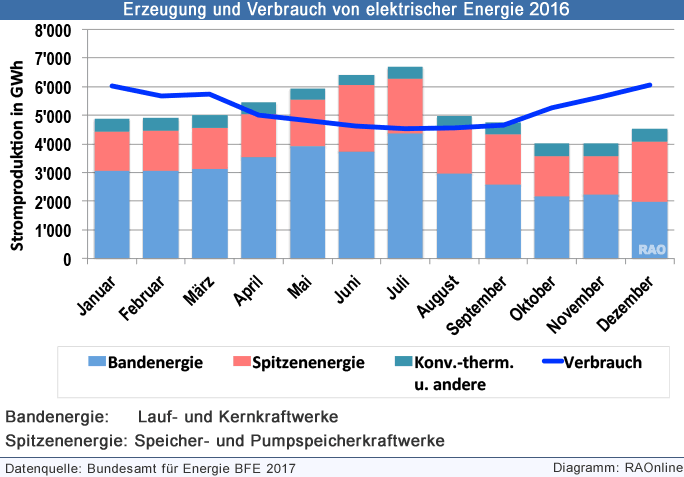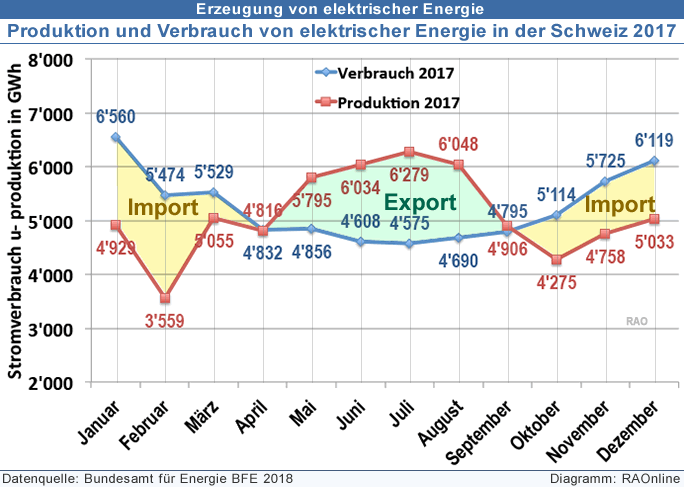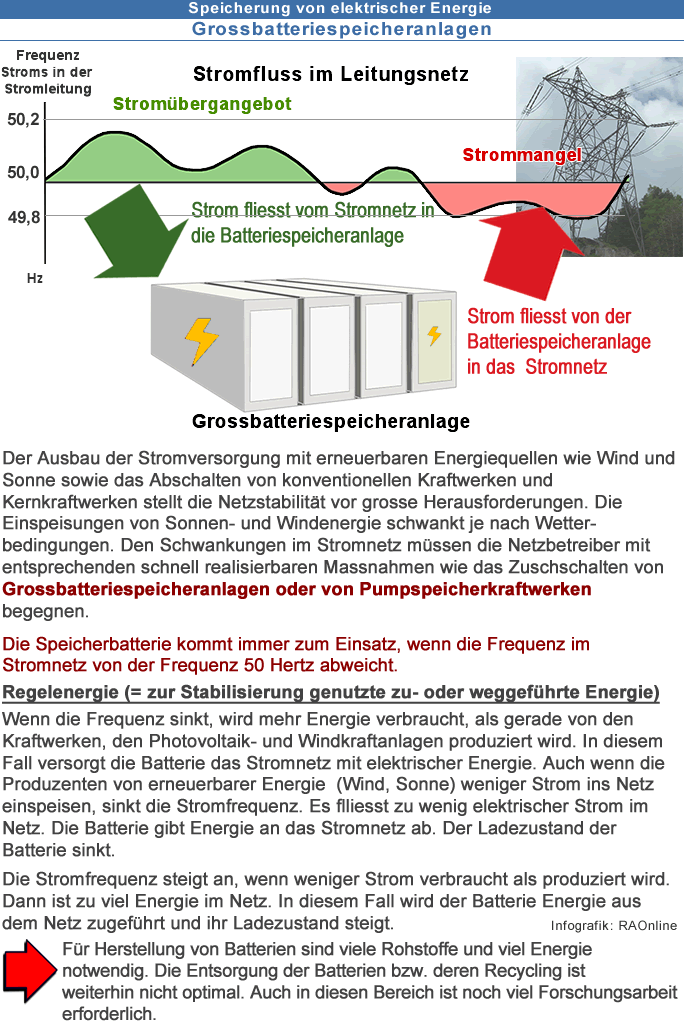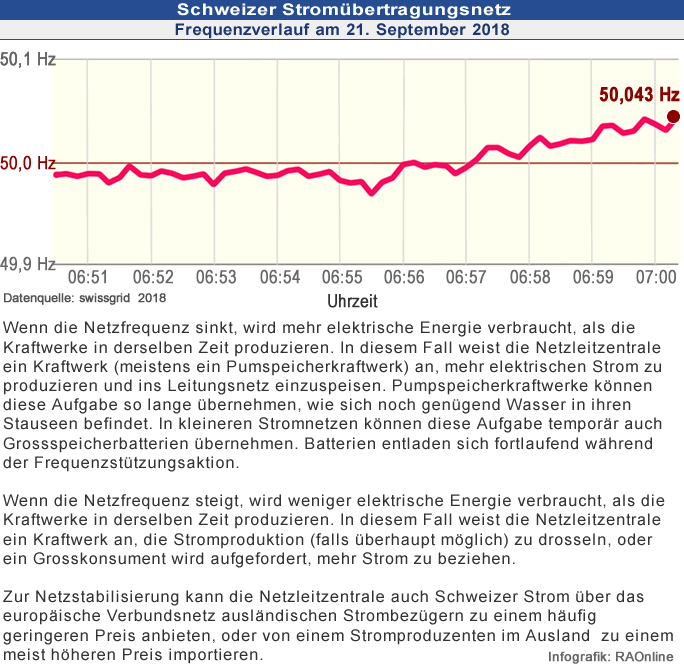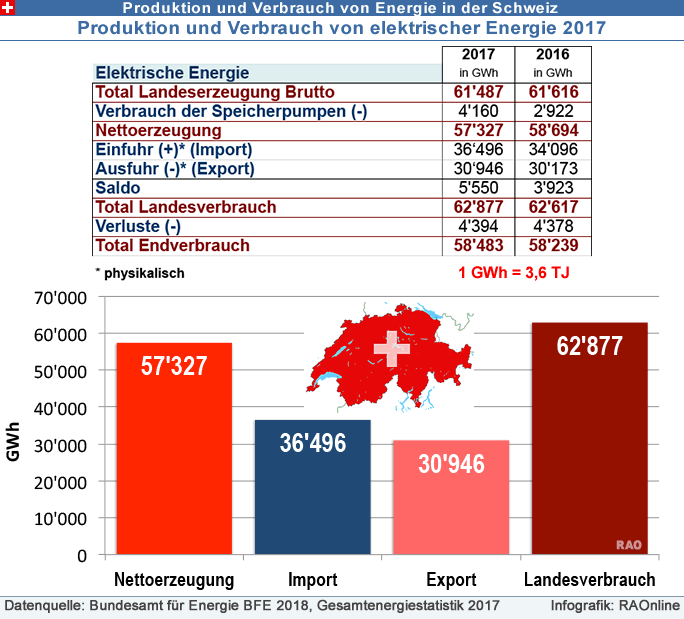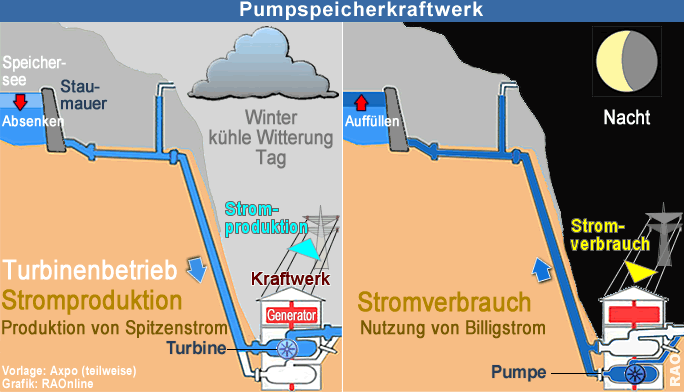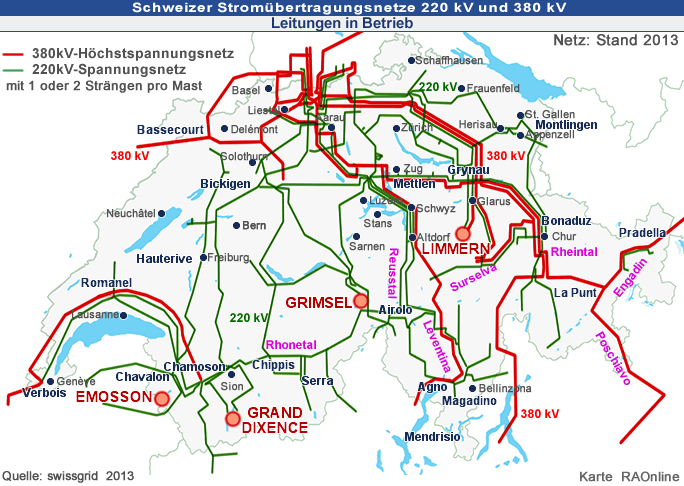|
Energie Schweiz Energieversorgung |
 |
Energie Schweiz Weitere Informationen |
|
| Swissgrid - Das Schweizer Stromübertragungsnetz |
 |
| Versorgungssicherheit: Netzsicherheit - Netzstabilität |
Die Produktion und der Verbrauch von elektrische Energie schwankt sowohl im Tages- wie auch im Jahresverlauf.
Das Stromübertragungsnetz muss trotz den teilweise starken Nachfrageänderungen stabil und sicher gehalten werden. Auch die schwankende Produktion bei Windkraft- und Solaranlagen muss berücksichtigt werden.
Regelleistung und Regelenergie
Eine sichere Versorgung mit elektrischem Strom ist nur bei einer Frequenz von 50 Hertz in den Stromleitungen möglich. Das Stromnetz wird mit einer Frequenz von 50 Hertz betrieben. Ein Frequenzabfall von nur 0,5 Hertz kann bereits zu einem Stromausfall führen. Zwischen der Produktion und dem Verbrauch muss ein konstantes Gleichgewicht herrschen.
 |
Da man elektrische Energie im Stromnetz nicht speichern kann, muss die ins Netz eingespeiste Menge an Energie zu jedem Zeitpunkt mit jener Menge übereinstimmen, die aus dem Netz entnommen wird. Trotz qualitativ hochwertiger Prognosen der Energieversorger für Produktion und Verbrauch ist eine exakte Planung dafür nicht möglich. Deshalb müssen auch kleinere Abweichungen von den Sollwerten kontinuierlich ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich findet grösstenteils durch die Anpassung der Stromproduktion an den aktuellen Verbrauch statt. Dafür sind Kraftwerke notwendig, deren Produktion sich besonders gut regeln lässt.
Dabei wird im europäischen Verbundsystem bei einer Unausgeglichenheit dreistufig vorgegangen. Mit der Primärregelung wird das Gleichgewicht innerhalb von Sekunden hergestellt. Reicht dies nicht aus, wird nach fünf Minuten die Sekundärregelung abgerufen. Bei Regelabweichungen länger als 15 Minuten wird die Sekundärregelung durch die Tertiärregelung abgelöst. Dabei erfolgt der Abruf der Primär- und Sekundärregelung automatisch, der Abruf der Tertiärregelung hingegen manuell. |
| Auszug aus: Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, Bericht Regelleistung und Regelenergie 2019 |
 |
Weicht die Frequenz unvorhergesehen von 50 Hertz ab, weil mehr verbraucht als produziert wird oder umgekehrt, muss kurzfristig Energie ins Netz geliefert oder aus dem Netz bezogen werden. Diese Energie nennt man Regelenergie.
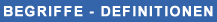 |
 |
| Regelleistung bzw. Regelenergie |
| Als nationale Netzgesellschaft sorgt Swissgrid dauernd für einen diskriminierungsfreien, zuverlässigen und leistungsfähigen Betrieb des Übertragungsnetzes als wesentliche Grundlage für die sichere Versorgung der Schweiz (Art. 20 Abs. 1 StromVG). Dazu sind einerseits genügend Produktionskapazitäten für die Erzeugung elektrischer Energie und anderseits ein ausreichend dimensioniertes Übertragungs- und Verteilnetz für den Energietransport zum Endkunden notwendig.
Da man elektrische Energie im Stromnetz nicht speichern kann, muss die ins Netz eingespeiste Menge an Energie zu jedem Zeitpunkt mit jener Menge übereinstimmen, die aus dem Netz entnommen wird.
Trotz qualitativ hochwertiger Prognosen der Energieversorger für Produktion und Verbrauch ist eine exakte Planung dafür nicht möglich. Deshalb müssen auch kleinere Abweichungen von den Sollwerten kontinuierlich ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich findet grösstenteils durch die Anpassung der Stromproduktion an den aktuellen Verbrauch statt. Dafür sind Kraftwerke notwendig, deren Produktion sich besonders gut regeln lässt. Swissgrid beschafft die dazu notwendige Regelleistung in einem marktorientierten, diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren (Art.22 Abs. 1 StromVV). |
|
| Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung |
| Dabei wird im europäischen Verbundsystem bei einer Unausgeglichenheit dreistufig vorgegangen:
Mit der Primärregelung wird das Gleichgewicht innerhalb von Sekunden hergestellt.
Reicht dies nicht aus, wird nach fünf Minuten die Sekundärregelung abgerufen.
Bei Regelabweichungen länger als 15 Minuten wird die Sekundärregelung durch die Tertiärregelung abgelöst. Dabei erfolgt der Abruf der Primär- und Sekundärregelung automatisch, der Abruf der Tertiärregelung hingegen manuell. |
|
 |
 |
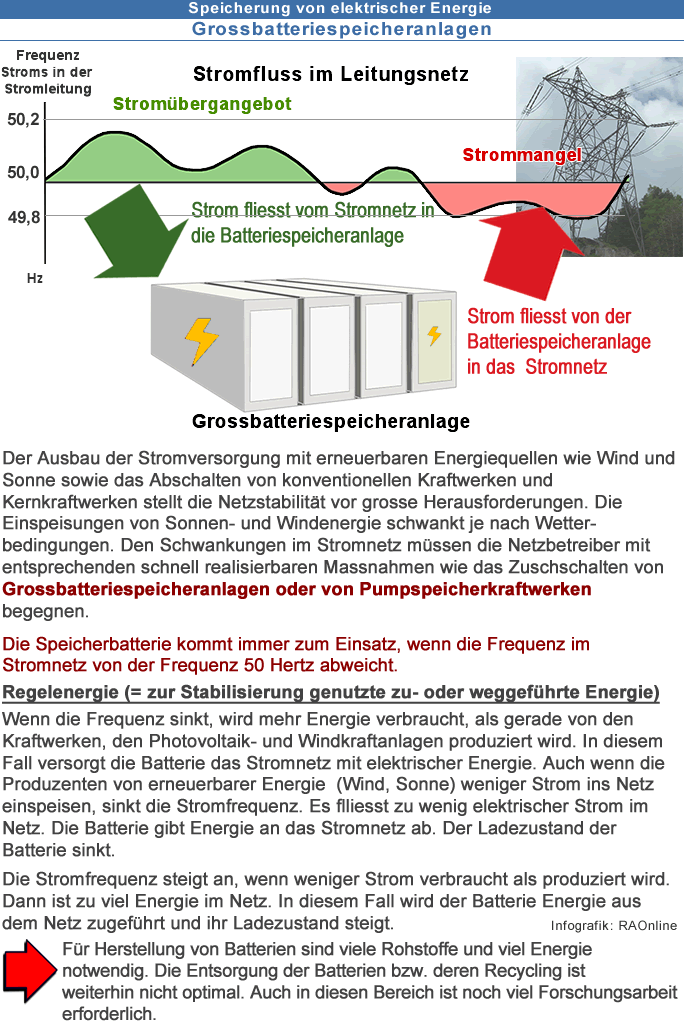 |
 |
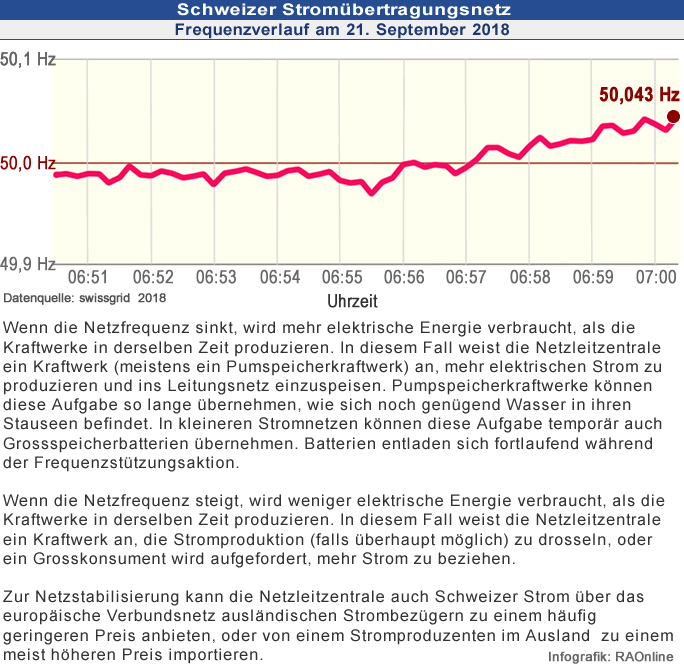 |
In Be- und Entlastungsphasen auf dem Netz werden daher Pumpspeicherkraftwerke zugeschaltet. Mit überschüssigem Strom wird Wasser in die Speicherseen hinauf gepumpt. In Zeiten mit starker Stromnachfrage treibt das Wasser aus diesen Stauseen die Turbinen und Generatoren in den Pumpspeicherkraftwerken an. Der so zusätzlichen erzeugte Strom wird unverzüglich ins nationale Hochspannungsnetz eingespeist. Pumpspeicherkraftwerke spielen daher eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Netzsicherheit.
Die Produktion von elektrischer Energie und ihre Einspeisung ins Stromübertragungsnetz ist abgesehen von einigen Sonderfällen (u.a. Notabschaltungen von Kernkraftwerken) planbar. Der Konsum der produzierten elektrischen Energie wird hingegen von vielen, zum Teil unvorhergesehenen Faktoren bestimmt und schwankt oft beträchtlich. Die Netzlast (= Ausspeisung) der ins Netz eingespeisten elektrischen Energiemenge ist unregelmässig. Die Netzbetreiber unterscheiden zwei Arten von Netzlasten: Last am Übertragungsnetz und die Gesamtlast.
 |
 |
|
Höchstspannungsnetze («Stromautobahnen») mit 380 kV transportieren grosse Mengen an elektrischer Energie über grosse Entfernungen. Grosse Pumpspeicherkraftwerke wie «Linthal 2015 - PSW Limmern » im Kanton Glarus, die Kraftwerke in der Region Grimsel im Kanton Bern oder künftig auch «Nant de Drance» im Kanton Wallis werden daher ans 380 kV-Höchstspannungsnetz angeschlossen. Im Pumpbetrieb benötigen diese Werke Strom aus dem nationalen Versorgungsnetz. Sie erhöhen während der Pumpphase die Last am Übertragungsnetz.
Es gibt kleinere Speicherkraftwerke und auch viele Flusskraftwerke, welche für einen lokalen Markt (Städte, Regionen) elektrischen Strom produzieren. Der Strom dieser Werke wird über untergelagerte Netze (Netze mit tieferer Spannungsebene, Verteilnetze) an die Kunden geliefert. Dieser Strom wird nicht ins Höchstspannungsnetz eingespeist und belastet dieses somit nicht.
| Quelle:
Swissgrid |
| Text: RAOnline |
 |
Netzsicherheit: Regeln von Angebot und Nachfrage
Im Stromnetz wird immer von den Stromproduzenten gleichviel elektrischen Strom eingespeist wie die Stromkonsumenten gleichzeitig verbrauchen. Zu viel oder zu wenig elektrischer Strom im Stromübertragungsnetz destabilisiert das Leitungsnetz.
Der Stromüberschuss kann durch den Verkauf auf dem internationalen Markt , das Zuschalten von Grossverbrauchern, das Zuschalten von Pumpen in den Pumpspeicherkraftwerken oder durch neue, dezentrale Speichertechnologien (Akku-Farmen usw.) abgebaut werden.
Bei Strommangel wird die Energie auf dem internationalen Markt eingekauft, die Grossverbraucher zugeschaltet oder die Pumpspeicherkraftwerke auf den Turbinenbetrieb umgestellt. Die dezentralen Stromspeicher versorgen in dieser Zeit die lokalen Netze mit Strom. Das Zusammenspiel aller Marktteilnehmer zur Erhaltung der Netzstabilität ist kompliziert und kann nur mit digitalen Mitteln bewältigt werden.
Durch den Trend, mehr Strom aus erneuerbaren Produktionsquellen wie Solar-, Biogas- oder Windkraftanlagen zu erzeugen, erscheinen immer mehr kleinere Stromproduzenten auf dem Markt. Die Produktion von Solar- und Windkraftanlagen ist von den Naturkräften Sonne und Wind abhängig. Die von diesen kleineren Anlagen produzierte Strommenge lässt sich von den Netzbetreibern weniger gut abschätzen. Die Netzbetreiber arbeiten daher an neuen Konzepten und neuen Technologien, welche dieser Entwicklung Rechnung tragen.
Grosse Stromproduzenten sind dazu übergegangen grössere Stromverbraucher wie u.a. Kühlhäuser oder Spitäler und Stromerzeuger wie u.a. Unternehmen mit gossen Fotovoltaikanlagen in einem "Pool" zusammenzuschliessen. Der Stromverbrauch und die Stromproduktion dieser Marktteilnehmer wird als "Gesamtpaket" an einer Börse für Regelstrom gehandelt. Der Regelstrom dient dazu, das nationale Netz zu stabilisieren. Die Kühlanlagen oder die Notstromgruppen dieser Unternehmen werden nach Bedarf zu- oder ausgeschaltet.
Das heutige Stromversorgungssystem wird von den Produzenten gesteuert und orientiert sich an der Nachfrage. In Zukunft müssen auch die Verbraucher ihren Beitrag für die Netzstabilität leisten. Das intelligente Netz, das «smart grid», analysiert und steuert die Nachfrage und die Produktion. Ein intelligentes Energiemanagement mit Hightech-Stromzählern hilft, Lastspitzen im Netz zu vermeiden. Die neue Technik ermöglicht, Geräte abschalten oder im Sparmodus zu betreiben. Durch intelligente Stromzähler, die «SmartMeter» können auch im Haushalt Stromverbraucher wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Kühltruhen, Wärmepumpen usw. überwacht und gesteuert werden (siehe: Industrie 4.0 - Vernetzung von Produkt, Maschine und Werkzeug).
| Text: RAOnline |
 |
 |
| Smart Grid |
intelligentes Stromnetz, das Stromerzeuger, Speicher, Verbraucher und Netzanlagen effizient und zuverlässig vernetzt und steuert. |
| Smart Home |
intelligentes Wohnen, bei dem Geräte aufgrund einer Datenvernetzung und Fernsteuerbarkeit intelligent (automatisch/optimiert) gesteuert werden. |
|
| Pumpspeicherkraftwerke: Für die Netzsicherheit- und die Netzstabilität |
 |
 |
| KWO - Pumpspeicherkraftwerke |
| Quellen: KWO und ABB |
| Oktober 2013 |
|
|
 |
| Erlebnis Naturwissenschaften |
|
 |
nach
oben
|
Links |
 |
 |
 |
Externe
Links |
|