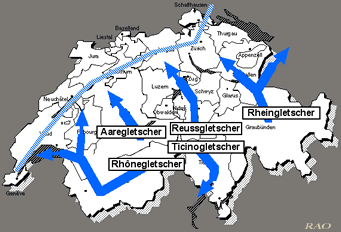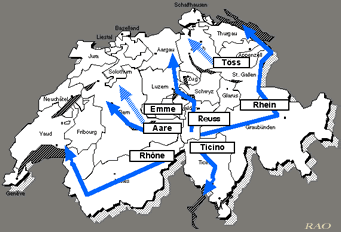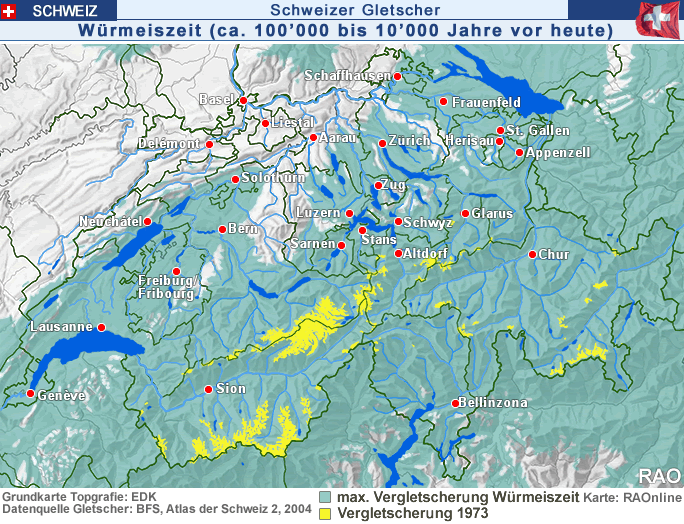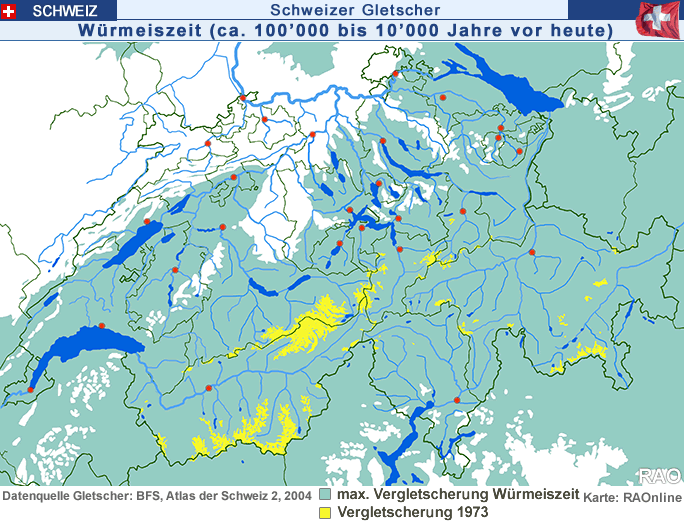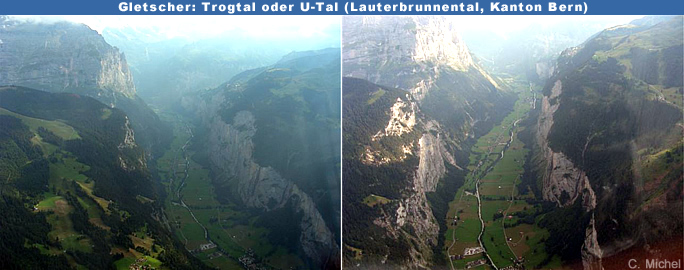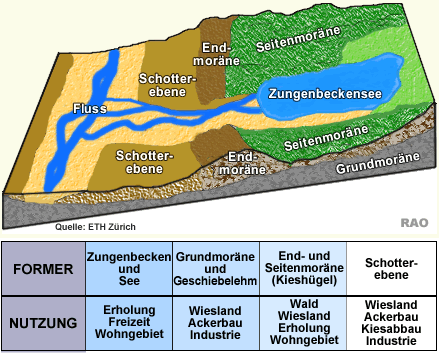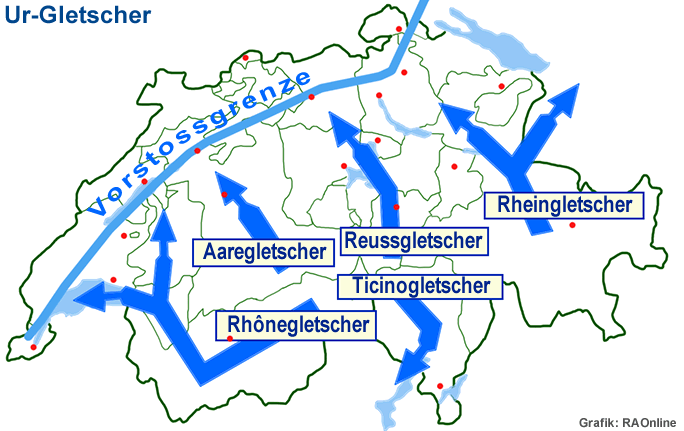|
Gletscher in der Schweiz Landschaften |
 |
Gletscher in der Schweiz |
|
|
Gletscher
formen die Landschaft
|
In
der letzten Eiszeit, das war vor gut 20'000 Jahren, waren
grosse Teile dieser Erde mit Eis bedeckt. Ganz Nordamerika lag unter einem
riesigen Eisschild. Es bestand aus zwei Teilen, dem eigentlichen Eisschild (in Kanada, Alaska und den nördlichen USA) und der Gebirgsvergletscherung
der Rocky Mountains. Am östlichen Rand waren das Eisschild mit dem
grönländischen Inlandeis verbunden. Das skandinavische Eisschild,
als zweites grosses Eisschild der Nordhalbkugel, reichte bis weit nach
Deutschland und Frankreich hinunter. Die beiden Eismassen waren zudem durch
einen riesige Schelfeis auf dem Atlantik miteinander verbunden.
Jedoch
für die Schweiz war es ein riesiges Gebiet. Denn beinahe die ganze
Schweiz war durch die Eismassen zugedeckt. Diese Vereisung schuf die
heutige Schweizer Landschaft. Die ganze Schweiz wurde durch diese Vereisung
geprägt. Die Gletscher schliffen viele Schweizer Berge ab und
das Schmelzwasser tiefte die Täler ein. Die eiszeitlichen
Gletscher lagerten viel Schutt und Geröll im Mittelland ab. Im
Vergleich mit der Eiszeit, ist heute nur ein winziger Teil der Erde vergletschert.
| Eiszeitlich
geprägte schweizerische Mittelland |
Die
Kombination aller Erosions- und Ablagerungsformen geben der Schweiz
ihr vielfältiges Landschaftsbild. Viele Endmoränen helfen
zum Beispiel mit, dass die Seen unseres Mittellands abgedämmt
werden. So werden Zürich-, Katzen-, Greifen- und Pfäffikersee durch
Endmoränen begrenzt. Die eiszeitlichen Ablagerungen haben zudem
eine wirtschaftliche Bedeutung. Das feine Material der Grundmoränen
bildet die Grundlage für fruchtbare Böden. Auf diesen
Böden wird heute intensiv Landwirtschaft betrieben.
Die enormen Schottermassen,
die durch das Schmelzwasser der Gletscher abgelagert wurden, bergen heute
grosse Grundwasservorkommen. In der Tiefe bildeten sich riesige Grundwasserströme,
die in vielen Orten das Trinkwasser liefern. Zudem können die
Schotter in Kiesgruben abgebaut werden. Dieses Material, Kies und
Sand, wird für die Betonherstellung im Hoch- und Tiefbau benötigt.
 |
|
Endmoräne
bei Seon, Seetal AG
|
Würm-Kaltzeit, Würm-Glazial, Würmeiszeit
Letzte grossflächige Vereisung des Alpenraums. Die Gletscher reichten in der Würmeiszeit über die Alpen hinaus. Sie ist die letzte eine Reihe von Vergletscherungen im Pleistozän. Die Würm-Kaltzeit begann vor vor etwas mehr als 100'000 Jahre vor unserer Zeitrechung und endete vor etwa 10'000 Jahren. Das Pleistozän ist ein geologischer Zeitabschnitt im Quartär. Erstreckte sich von rund 2 Millionen Jahre bis zirka 10'000 Jahre vor heute.
| Nacheiszeitliche
Gletscherschwankungen |
Bevor
man genau wusste, wie sich Gletscher bewegen und wie sie mit der Landschaft
umgehen, sagte Albert Heim, ein berühmter Schweizer Naturforscher:
'mit Butter hobelt man nicht'. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass
es für ihn unmöglich schien, dass weiches Eis den harten Fels
abschleifen konnte. Eigentlich hat er damit nicht Unrecht. Jedoch kannte
er die genauen Zusammenhänge nicht. Tatsache ist, dass die Gletscher
der letzten Eiszeit unsere Berge abschliffen und so eine reichhaltige Landschaft
schufen. Damals waren alle Alpentäler mit Gletschern ausgefüllt.
Sie schufen die charakteristischen U-Täler, von denen man heute
spricht.
Vor gut 10'000 Jahren war die Eiszeit zu Ende. Die Gletscher
zogen sich immer weiter zurück. Nur einmal, vor gut 150 Jahren, stiessen
die Gletscher noch einmal vor. Diese Zeit nennt man darum heute auch die 'kleine
Eiszeit'. Diesen Vorstoss kann man heute noch an vielen historischen
Moränen (Moränen sind Schuttablagerungen von Gletschern)
aus der Zeit von 1850 nachvollziehen. Seit diesem letzten Vorstoss ziehen
sich die Gletscher jedoch immer weiter in die Gebirgsflanken zurück.
Man weiss heute nicht, wie lange wir in der Schweiz noch Gletscher haben
werden. Denn die seit 20 Jahren beobachtete Erwärmung unseres Klimas
setzt den Gletschern arg zu.
nach
oben
| Einfluss
von Gletschern auf die Landschaft |
Gletscher
verändern die Landschaft! Wie kann der Gletscher aber wirklich den
Fels abtragen und eine Vielzahl von Formen hervorbringen? Die genauen Zusammenhänge
sind bis heute noch nicht ganz geklärt. Man weiss aber, dass Gletscher
an ihrer Unterseite immer etwas Gesteinsmaterial mitführen. In dem
viele Steine an die Unterseite des Gletschers anfrieren, entsteht eine
Art Sandpapier. Mit Sandpapier können wir Holz zuschleifen. Genauso
muss man sich das vorstellen. Das enorme Gewicht der Gletscher drückt
seine rauhe Unterseite gegen den Fels und schleift ihn ab. Gefriert das
Eis am Untergrund an, so ist es möglich, dass ganze Steinbrocken aus
dem Fels gerissen werden, wenn der Gletscher talwärts fliesst.
| Abtragsformen
(Erosionsformen) |
Hierunter
versteht man Formen, die durch eine äussere Kraft, wie sie ein Gletscher
oder fliessendes Wasser ausüben, geschaffen wurden. Hier einige Beispiele:
| Rundhöcker: |
Diese walrückenförmigen
Hügel werden durch die abschleifende Wirkung des oben genannten
Sandpapiers geschaffen. Rundhöcker haben eine flache Luv- und eine
steile Leeseite. (Die Luvseite ist die Seite, von der der Gletscher kam).
Am Rundhöcker kann man somit immer erkennen, woher der Gletscher kam. |
| Gletscherschliff: |
So
nennt man Kratzer und Schrammen auf Felsoberflächen. Sie bilden
sich auch durch das Abschleifen. Sie werden bis zu mehreren Kilometer lang
und entstehen unabhängig von der Gesteinsart oder der Felsausbildung. |
| Trogtäler: |
Sie
werden vielfach auch als U-Täler bezeichnet. Sie wurden währen
der Eiszeit in der Schweiz durch Abtragung und das Ausräumen der Gesteinsbrocken
aus dem Tal geschaffen. Sie werden durch steile Seitenwände (Trogwand) begrenzt und zeigen oben oft eine Kante, die zu einem flacheren Hang überleitet.
Dieser Bereich wird als Trogschulter bezeichnet. Solche Trogschultern
sind oft überreste des voreiszeitlichen Tales. |
| Kar: |
Kare
sind kesselförmige Eintiefungen unterhalb der Berggrate mit
flachem Boden und steilen Rückwänden. Sie sind wie die Trogtäler
eine vom Gletscher geschaffene Ausräumungsform, aber mit kleinem Ausmass.
Aus diesen Karen strömten die eiszeitlichen Talgletscher in
die tieferliegenden Täler hinunter. |
| Gletschermühlen: |
Schmelzwasser,
dass durch Gletscherspalten in die Tiefe stürzt, fliesst unter
dem Gletscher weiter, wobei es unter sehr hohen Druck gerät. Da es
Sandpartikel enthält, schleift es sich an engen Stellen in das untenliegende
Felsbett ein. Die dabei erreichten Fliessgeschwindigkeiten des Wassers
können 200 km/h betragen. Mit der Zeit bilden sich tiefe Löcher,
die wir Gletschermühlen oder -töpfe nennen. Manchmal findet
man auch grosse und kleine Findlinge in den Gletschermühlen.
Es stimmt übrigens nicht, dass diese durch Drehung die Gletschermühlen
geschaffen haben sollen! |
 |
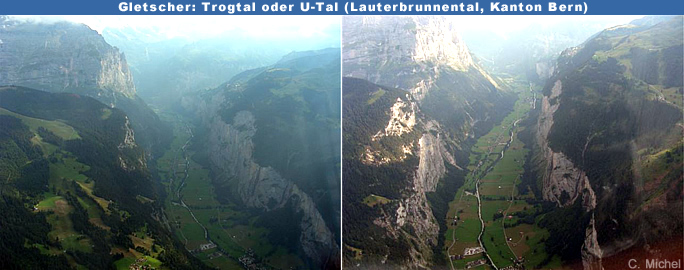
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Gletschermühlen
bei Salvan, Wallis
|
nach
oben
| Ablagerungsformen
(Akkumulationsformen) |
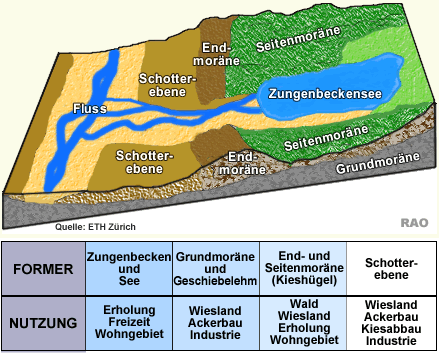 |
| Moränen
sind wohl die bekanntesten Ablagerungsformen der Gletscher. Sie
bestehen aus Schutt und Geröll unterschiedlicher Grösse.
Die
Komponenten sind eckig bis kantengerundet. Je nach Moränentyp
findet man mehr oder weniger viel Tonanteil.
Die
Zusammensetzung der Moränen hat einen starken Einfluss auf
die Böden, die sich daraus bilden und somit auf den Menschen, der
diese Böden landwirtschaftlich nutzt. |
|
Es
gibt vier verschiedene Moränentypen: Grund-,
Seiten-, Mittel- und Endmoränen
| Grundmoräne |
Sie
wird durch das Material gebildet, das aus den steilen Felswänden in
den Bergschrund fällt. Dieses Material wird dann nahe dem Boden
im Gletscher mittransportiert, durch den Druck fein zermahlen und in Vertiefungen
abgelagert.
Hierunter
versteht man Formen, die durch eine äussere Kraft, wie sie ein Gletscher
oder fliessendes Wasser ausüben, geschaffen wurden. |
| Seitenmoräne |
Material,
das von steilen Felswänden auf den Gletscher fällt, wird auf
dessen Oberfläche talwärts mittransportiert. An den steilen Flanken
des Gletscher fällt es schliesslich herunter und wird seitlich vom
Gletscher abgelagert. Es besteht aus grossen Gesteinsbrocken, die meist
eckige Umrisse haben, und Feinmaterial. |
| Mittelmoräne |
Sie
entstehen an der Stelle, wo sich zwei Gletscher vereinen. Es sind immer
die Seitenmoränen die sich dann zu einer einzigen Mittelmoräne
zusammenschliessen. |
| Endmoräne |
Der
Gletscher schiebt an seiner Front Material vor sich hin (Stirnmoräne).
Zieht sich der Gletscher in einer wärmeren Phase zurück, so bleibt
das Material liegen und bildet eine sichelförmige Endmoräne. |
| Eratiker |
sind
kleine bis grosse Steine die man im Vorfeld eines eiszeitlichen Gletschers
gefunden hat. Man konnte sich früher nicht vorstellen woher diese
Steine kamen, denn sie passten nicht in die geologische Region, in der
man sie fand. Als man dann erkannte, dass die Schweiz einmal mit riesigen
Gletscher zugedeckt war konnte man erklären, wie diese Steine ins
Mittelland kamen. Als Leitgesteine bezeichnet
man ganz bestimmte Eratiker, bei denen man genau sagen kann aus welchem
Gebirge sie stammen. |
Schmelzwasser-
schotter
(Sander) |
entstehen,
wenn sich der Gletscherbach durch die Endmoräne schneidet und
sein mitgeführtes Geschiebe auf ein grosses Gebiet im Vorfeld der
Gletscher verteilt. Das grobe Material bleibt nahe der Moräne liegen.
Aber das feine Material, wie Kies und Sand, wird weit auf das Gletschervorfeld
hinaus getragen und dort abgelagert. Im Gegensatz zu den Moränen besteht
der Sander aus gut gerundeten Geröllen, die durch den
Transport im Wasser abgeschliffen wurden. Die typische Abfolge von Gundmoräne
mit Zungenbeckensee, Endmoräne und Schotterebene nennt man
übrigens glaziale Serie. |
 |
 |
 |
 |
| Drumlinlandschaft im Kanton Zug
Drumlins sind ein wesentlicher Bestandteil einer Grundmoränenlandschaft.
Sie wurden wahrscheinlich bei einem erneuten Vorstoss der Gletscher aus
der Grundmoräne gebildet. Sie haben eine ähnliche Form wie Rundhöcker,
bestehen aber nicht aus Fels sondern aus unsortiertem Moränenmaterial.
Zudem haben sie die steilere Böschung nicht auf der Leeseite sondern auf der Luvseite. |
|
 |
|
Seitenmoräne
bei Seengen, Seetal AG
|
 |
|
Endmoräne
bei Seon, Seetal AG
|
 |
|
Endmoräne
bei Seon, Seetal AG
|
 |
|
Endmoräne
bei Seon, Seetal AG
|
 |
|
Endmoräne
bei Seon, Seetal AG
|
nach
oben
| Leitgesteine der Gletscher |
 |
| Rheingletscher |
Julier-Granit, Muschelsandstein |
| Linthgletscher |
Glarner Verrucano |
| Reussgletscher |
Windgällen-Porphyr |
| Aaregletscher |
Grimselgranit |
| Rhônegletscher |
Arolla-Gneise, Mt. Blanc-Granit, Vallorcine-Konglomerat |
|
| Quelle:
EducETH Gletscher Puzzle |
|
Weitere Informationen
|
 |
|